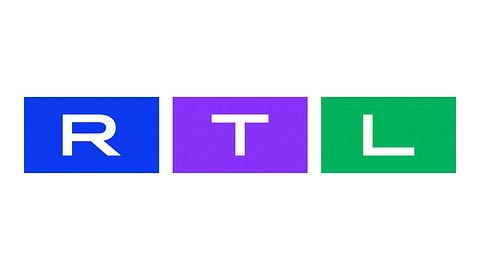„Thunderbolts*“ – Kritik: Marvels „B-vengers“ erhalten ihre Daseinsberechtigung
Die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe endet mit „Thunderbolts*“. Dabei setzt der Film auf die Stärken der Helden aus der zweiten Reihe. Aber lohnt sich der Film?

Die Avengers sind sicherlich das bekannteste Superhelden-Team im MCU, doch sowohl auf der großen Leinwand als auch in den Comics mangelt es Marvel nicht an Gruppierungen, die sich gegenseitig perfekt ergänzen. Das setzt voraus, dass alle Teammitglieder ihre ganz eigenen Stärken und Fähigkeiten mitbringen und erst lernen müssen, dass ihre Unterschiede eigentlich ein großer Vorteil sind.
Das gilt für die X-Men, die Fantastic Four und sogar weniger gefragte Teams wie die Defenders oder die Inhumans. Es gilt jedoch nicht für die Thunderbolts, was das neueste Marvel-Teamup auf eine unerwartete Weise besonders macht. Die Mitglieder der Thunderbolts sind nicht nur typische Helden aus der zweiten Reihe, die in früheren MCU-Projekten als Nebenrolle oder sogar Schurken auf den Plan traten, sie sind auch gar nicht so verschieden.
Zwar verfügen fast alle von ihnen über spezielle Fähigkeiten, doch im Kampf wird eigentlich nur geschossen und geschlagen – etwas, was Yelena Belova (Florence Pugh) selbst anmerkt, als die Thunderbolts am Boden eines langen Schachts stehen und nicht nach oben kommen. Niemand von ihnen kann fliegen, niemand hat die Kraft eines Hulk, mit der sich Wände einfach einreißen ließen.
It’s a Feature, not a Bug

Allein dadurch ist „Thunderbolts*“ ein anderer, bewusst kleinerer Film. Die Lagerhalle, die aus dem Trailer bekannt ist und in der sich die Thunderbolts erstmals begegnen, wird erstaunlich spät wieder verlassen, und auch anschließend gibt es nur wenige Schauplatzwechsel oder andere Erinnerungen daran, dass man es hier mit einem großen Marvelfilm und dem letzten Puzzlestück von Phase 5 zu tun hat.
„Thunderbolts*“ scheint für die Zukunft des MCU wichtiger zu sein als beispielsweise „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, „Eternals“ oder „Thor: Love and Thunder“, doch das liegt eher an den Grundsteinen, die der Film legt, und weniger an den tatsächlichen Ereignissen.
Das ist nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, soll aber dazu dienen, dass Marvelfans ihre Erwartungen vor dem Kinobesuch entsprechend anpassen. Man bekommt hier den Film, den die Trailer und Poster versprechen, ohne große Cameos oder schockierende Wendungen. Dabei setzt „Thunderbolts*“ aber vor allem in der zweiten Hälfte auf seine Stärken – und einen Marvelbösewicht, der glücklicherweise mal nicht enttäuscht, sondern positiv überrascht.
Ein Herz für Bob!
Nachdem Lewis Pullman als Bob (kurz für „Baby on Board“) bereits den unscheinbarsten Piloten in „Top Gun: Maverick“ gespielt hat, begegnet er uns nun in „Thunderbolts*“ als mysteriöser und unscheinbarer … Bob. Ein seltsamer Zufall, allerdings handelt es sich diesmal um die tatsächliche Kurzform seines Namens Robert, wobei Marvelfans natürlich schon wissen, dass wir es hier eigentlich mit Sentry zu tun haben, einem durch Experimente entstandenen Superhelden.
Dabei erinnert Sentry mehr an Adam Warlock aus „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ und weniger an Captain America, denn Sentrys Fähigkeiten scheinen keine Grenzen zu kennen. Allerdings war Bob eigentlich ein Testsubjekt und nicht als allmächtiger Held gedacht, und durch sein emotionales Ungleichgewicht – mal stark depressiv, mal größenwahnsinnig – wird er zu einem äußerst interessanten Gegenspieler, bei dem auf die Marvel-typische Schwarz-Weiß-Zeichnung verzichtet wird.
Eine positive Überraschung (ganz ohne große Überraschungen)

Es kam schon häufiger vor, dass Personen Superkräfte erlangen, die sie nicht verdienen oder aus eigennützigen Gründen nach Macht streben. Sentry ist aber eher interessiert, er hinterfragt seine neue Stellung im Universum und erinnert dadurch eher an Dr. Manhattan aus „Watchmen“.
„Thunderbolts*“ fehlt natürlich die Zeit, um den Heldenbegriff so sehr zu hinterfragen, wie Alan Moore es in seinem bahnbrechenden Graphic Novel tat, aber Sentry erweist sich wider Erwarten als der perfekte Gegenspieler für die Thunderbolts, obwohl er ihnen rein kräftemäßig haushoch überlegen ist.
Letztendlich ist „Thunderbolts*“ nämlich ein Film über komplizierte Emotionen, Reue und den Wunsch nach einer guten Zukunft, nachdem man eine schreckliche Vergangenheit hatte. Die besten Bösewichte des Superheldenkinos waren die, die nicht aus reiner Bosheit, sondern aus Verzweiflung oder einem missglückten Experiment auf die falsche Seite der Gerechtigkeit gerieten.
Das mag auf dem Papier vielleicht nicht so spannend klingen wie tausend Aliens, die New York angreifen, aber Geschichten über Helden leiden nicht selten an schwach gezeichneten oder gesichtslosen Schurken. „Thunderbolts*“ dreht diese Problematik um und liefert uns einen mehrdimensionalen Antagonisten, durch den im Umkehrschluss auch die Helden viel interessanter werden, als man es ihnen je zugetraut hätte.