Mit „Bridgerton“ haben die Macher:innen der Serie versucht, das historische Setting der Erzählung auf eine moderne, progressive Weise aufzuarbeiten. Doch wie gut ist das gelungen?

- „Bridgerton“-Kritik: Der „Female Gaze“ als feministisches Film-Werkzeug
- „Bridgerton“: Sind die Figuren Feminist:innen?
- „Bridgerton“: Body Positivity dank Penelope Featherington
- „Bridgerton“: Hat die Serie ein Rassismusproblem?
- „Bridgerton“: Heteronormativität und queere Liebe
- Wie progressiv und feministisch ist „Bridgerton“ wirklich?
Der Hype der Stunde gilt zweifelsohne der Netflix-Serie „Bridgerton“. Und zwar nicht nur wegen der romantischen Lovestories oder der aufwendigen Kulissen und Kostüme, sondern ganz besonders wegen der außergewöhnlich modernen Herangehensweise an eine Geschichte, die eigentlich zu Beginn des 19. Jahrhunderts spielt. Ob es um die Schwarze Königin, eine Plus-Size-Frau in einer Hauptrolle, die angedeuteten queeren Beziehungen für die kommende Staffel oder auch nur um die von einem Streichquartett interpretierte Version von Pitbulls Club-Hit „Give me everything“ aus dem Jahr 2011 geht – Produzentin Shonda Rhimes ist es auf vielen Ebenen gelungen, die Buchvorlage von Autorin Julia Quinn im Hinblick auf Feminismus, Vielfalt und Diversität ins Jahr 2024 zu bringen – oder? Eine feministische Analyse!

„Bridgerton“-Kritik: Der „Female Gaze“ als feministisches Film-Werkzeug
Ja, das größte Ziel der meisten Bridgerton-Frauen ist es, den passenden Ehemann zu finden. Trotzdem setzen die Produzent:innen des Streaming-Hits auf ein ganz bestimmtes Werkzeug, um die klassischen Liebesgeschichten durch eine feministische Brille zu erzählen. Denn anders als die meisten Filme und Serien wird „Bridgerton“ nicht durch den sogenannten „Male gaze“, also den männlichen Blick auf die Dinge, auf die Welt und auf Frauen, erzählt. Der Male Gaze sexualisiert und objektiviert Frauen typischerweise, zeigt sie nicht als handelnde Personen, sondern als passives Objekt, als Requisite – man denke etwa an die Bond Girls aus „James Bond“. Bei „Bridgerton“ hingegen bediente man sich dem „female gaze“, einer bewussten, feministischen Gegenbewegung, durch die Frauen und Männer gleichermaßen als komplexe Figuren mit einer komplexen Gefühlswelt gezeigt werden. Und das wird besonders in der Darstellung von Sexualität und Macht deutlich.
Female Gaze bei „Bridgerton“: Facettenreiche Sexualität
Anstatt Frauen zu objektivieren und lediglich als das Objekt der Begierde von Männern zu inszenieren, widmet sich „Bridgerton“ vor allem der Erzählung von weiblicher Lust und dem weiblichen Begehren. Sexualität wird durch das Zusammenspiel von Spannung und Sehnsucht erzählt und klassische Sehgewohnheiten bewusst umgekehrt. Man denke etwa Schlüsselszenen, wie den Duke, der sinnlich einen Dessertlöffel ableckt (Staffel 1) oder Anthony, der ins Wasser fällt, wodurch das weiße Hemd transparent an seinem muskulösen Oberkörper klebt (Staffel 2). Szenen, die wir aus anderen Filmen durchaus kennen, allerdings mit Frauen in den Rollen von Anthony und dem Duke. „Bridgerton“ stellt stattdessen bewusst das Begehren der Protagonist:innen in den Vordergrund – und zwar auch in den Sex-Szenen.

Female Gaze bei „Bridgerton“: Wer hat die Macht?
Doch was soll die typisch abwertende Darstellung von Frauen als „Klatschweiber“, könnte man sich in diesem Zusammenhang fragen. In dem historischen Kontext, in dem die Serie spielt, brachten vor allem Geheimnisse und Informationen eine gewaltige – und die einzige – Handlungsmacht für Frauen mit sich. Und die wird seither abgewertet, indem man sie typischerweise als Klatsch abtut. Hinzu kommt, dass Frauen zu dieser Zeit kaum andere Möglichkeiten hatten, sich die Zeit zu vertreiben. Sich dieses „Klatsch“-Wissen zunutze zu machen, bedeutet demnach auch, sich zu bemächten und zu emanzipieren. Das wird vor allem in der aktuellen, dritten Staffel deutlich, in der (ACHTUNG, SPOILER) Penelope nicht nur offenbart, eine Menge Geld als Lady Whistledown verdient zu haben, sondern so auch ihre Familie vor dem gesellschaftlichen Ruin bewahrt.
Mehr zu „Bridgerton“:
- „Bridgerton“: Nächstes Spin-off in Staffel 3 angedeutet?
- "Bridgerton"-Ende bei Netflix: Diese Serien kannst du stattdessen schauen!
- "Bridgerton" - Staffel 4: Showrunnerin kündigt gleich mehrere Ausstiege an!
„Bridgerton“: Sind die Figuren Feminist:innen?
Doch nicht nur Penelope gilt durch ihren Intellekt und ihr Geschäft mit Lady Whistledown als eine der emanzipiertesten Figuren der Serie. Ohne Frage findet man bei „Bridgerton“ gleich mehrere starke weibliche Figuren – von Lady Danbury über Queen Charlotte bis zu Kate Sharma. Doch vor allem Eloise Bridgerton wird als – nicht ganz so heimliche – Feministin der Serie gefeiert. Schließlich weist sie nicht nur eloquent und provokativ auf die massiven gesellschaftlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern hin, sondern weigert sich auch, einen Ehemann zu finden. Als eine der wenigen Figuren stellt sie damit patriarchale Gesellschaftsstrukturen und die männliche Machtposition infrage, anstatt sie zu bestätigen. So träumt sie von einem autonomen, unkonventionellen Leben in Freiheit – das sie sich zum Ende der dritten Staffel auch geschickt sichert.
Auch die männlichen Figuren der Serie werden bewusst vielschichtig gezeigt. Sie haben ebenso Probleme, sich dauerhaft in den patriarchalen Gesellschaftsstrukturen zurecht zu finden und leiden zum Teil unter toxischer Maskulinität, die sie glauben, erfüllen zu müssen. Man denke an Anthony, der das Gefühl hat, sich dem Druck, das Familienoberhaupt zu sein, ohne Schwächen stellen zu müssen oder an Colin, der von seinen Reisen zurückkehrt und seine gefühlvolle Art in die eines distanzierten Casanovas verwandeln will, weil er glaubt, das man genau das von ihm erwartet. Auf diese Weise kritisiert die Serie vermeintlich „typisches männliches Verhalten“ und erlaubt es auch Männern, sich in einer komplexen Gefühlswelt zu bewegen.

„Bridgerton“: Body Positivity dank Penelope Featherington
Die aktuelle Staffel wird von vielen Fans vor allem dafür gefeiert, dass Penelope Featherington als Plus-Size-Frau im Zentrum der Lovestory steht. Auch wenn viele Filme- und Serienmacher:inner inzwischen darauf achten, verschiedene Körpertypen zu zeigen, finden dicke Frauen und Charaktere jedoch meist nur in Nebenhandlungen statt: Sie sind die lustige beste Freundin oder die unbeliebte Mitschülerin. Das „Bridgerton“ mit dieser Tradition bricht und mit Nicola Coughlan eine Schauspielerin gewählt hat, die – zumindest im weitesten Sinne – Plus-Size ist, ist ein großer Schritt. Davon abgesehen ist die Vielfalt an Körpertypen jedoch recht überschaubar - um nicht zu sagen: nicht vorhanden. Nicht nur, dass Nicola Coughlan sich am untersten Spektrum der Plus-Size-Range bewegt, sie ist auch weit und breit die einzige kurvige Figur im „Bridgerton“-Universum. Alle anderen Schauspieler:innen entsprechen schlanken, normschönen Körperformen und bestätigen normative Schönheitsstandards.

„Bridgerton“: Hat die Serie ein Rassismusproblem?
Dass für eine historisch angesiedelte Serie wie „Bridgerton“ ein diverser Cast zusammenstellt und gleich mehrere Rollen – inklusive der Königin Charlotte – mit Schwarzen Schauspieler:innen und BIPOC besetzt wurden, sorgt immer wieder für gespaltene Meinungen. Schließlich sind People of Color auch in der Filmbranche noch immer deutlich unterrepräsentiert und werden aufgrund rassistischer Strukturen häufig in Nebenrollen oder als Antiheld:innen besetzt. Dem entgegenzuwirken, indem gezielt Schwarze Schauspieler:innen gecastet werden, ist ein wichtiger und richtiger Schritt, den die Produzent:innen von „Bridgerton“ gegangen sind.
Andererseits wird häufig kritisiert, dass die diverse Besetzung des Casts das große Rassismus-Problem der Zeit, in der die Serie spielt, nicht nur verharmlose, sondern sogar verleugne. Schließlich ist es ein historischer Fakt, dass die Londoner Adelsgesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahezu ausschließlich weiß war und People of Color systematisch ausbeutete. Indem die Vergangenheit gänzlich neu inszeniert wird, statt tatsächliche Machtstrukturen zu thematisieren, verkenne man dieses Problem, argumentieren Kritiker:innen. Die Macher:innen der Serie entgegnen, dass Königin Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz auch in Wirklichkeit Schwarze Vorfahr:innen gehabt haben soll. Man habe sich die künstlerische Freiheit erlaubt, sich die Gesellschaft ihrer Zeit vielfältiger vorzustellen. Gegenüber der „New York Times“ bezog Serienschöpfer Chris van Dusen hierzu Stellung und betonte, die Hautfarbe würde in der Serie durchaus eine Rolle spielen. Wirklich deutlich wird das allerdings erst im Prequel „Queen Charlotte“. Hier wird erklärt, dass Schwarze Menschen in einem „großen Experiment“ in die Adelsgesellschaft aufgenommen wurden. Dem Rassismus und Klassizismus der Zeit wurde also bewusst entgegengesteuert. In den Köpfen der feinen Gesellschaft scheint das auch fabelhaft funktioniert zu haben. Denn internalisierte rassistische Strukturen scheinen nicht zu existieren, sodass die Hautfarben in der Hauptserie schlicht nicht mehr zum Thema gemacht werden. Ob auf diese Weise eine Welt gezeichnet wird, die man sich wünscht, oder ob es sich um ignorante Gleichgültigkeit gegenüber reellen Problemen handelt, bleibt wohl Ansichtssache.
„Bridgerton“: Heteronormativität und queere Liebe
Doch auch, wenn die Serie in Punkto körperlicher und ethnischer Vielfalt versucht, Diversität abzubilden, ließ ein Thema bisher erheblich zu wünschen übrig: Denn jede Staffel erzählte eine heteronormative Liebesgeschichte. Queerness und gleichgeschlechtliche Liebe fanden lediglich in der Nebenhandlung des Spin-offs „Queen Charlotte“ statt. Dort hatten die beiden Diener von König George und Königin Charlotte – Brimsley und Reynolds – ein heimliches Verhältnis miteinander. Doch das soll sich nun ändern: Das kündigte Showrunnerin Jess Brownell im Interview mit „TV Insider“ an: „Wir erforschen in den nächsten Staffeln queere Liebesgeschichten. Es war mir wichtig, queere Liebe in den Vordergrund zu stellen und queere Geschichten zu erzählen.“ Einen Auftakt gab es dafür schon in Staffel 3, als Benedict Bridgerton sich auf eine Dreiecksbeziehung mit Lady Tilley und ihrem guten Freund Paul einlies. Wo die Reise der queeren Liebesgeschichte hingeht, wurde zum Staffelfinale auch angedeutet: So wird sich Francesca Bridgerton vermutlich in eine Frau verlieben. Denn: Wer die Bücher kennt, weiß, dass Lord Kilmartin nicht an ihrer Seite bleiben wird. Stattdessen wird sie seinen Cousin Michael heiraten. Zum Staffelende wurde dieser jedoch als Michaela eingeführt!

„Bridgerton“: Ein queerer Cast
Produzentin Shonda Rhimes ist dafür bekannt, schon bei der Zusammenstellung eines Serien-Castes auf Diversität zu achten: Und die endet nicht bei der Hautfarbe. Anthony Bridgerton Darsteller Jonathan Bailey lebt etwa offen homosexuell und wird dafür innerhalb der Branche hoch gelobt. Denn leider ist es bis heute nicht selbstverständlich, sich zu outen, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Da Hauptrollen seltener an homosexuelle Schauspieler:innen vergeben werden, gehen nicht alle so offen mit ihrer Sexualität um. Im „Bridgerton“ Cast ist Jonathan Bailey mit seiner Offenheit jedoch nicht allein: Auch Kollegin Jessica Madsen, die die Rolle der Cressida Cowper spielt, verkündete während des Pride Month, dass sie mit einer Frau zusammen ist.
Wie progressiv und feministisch ist „Bridgerton“ wirklich?
Wer die Serie gebinged hat, weiß: Immer wieder lassen sich feministische Referenzen finden, die eine moderne, progressive Gesellschaft zeichnen, in der strukturelle Machtprobleme wie Rassismus oder Fettfeindlichkeit nicht existieren – das Patriarchat allerdings schon. Im Fokus stehen dabei jedoch – wie sollte es auch anders sein – die romantische Liebe, die Männer und Frauen schließlich auf Augenhöhe bringen soll. Und das ist doch schon mal ein schöner Anfang!
- Ein Kommentar von Kimberly Hofmann -

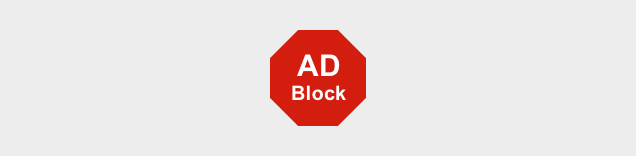 1. Klicke neben der Adresszeile rechts auf das Ad-Blocker-Symbol.
1. Klicke neben der Adresszeile rechts auf das Ad-Blocker-Symbol.
 2. Wähle die Option "Deaktivieren auf: www.tvmovie.de".
2. Wähle die Option "Deaktivieren auf: www.tvmovie.de".









